Muss man sich zwischen aufregend und lebenswert entscheiden?
von Chiara Pellegrini.
Sauber und kuschlig kann eine großartige Metropole nun mal nicht sein, meint John Kay. Warum lebenswerte Städte zwar die Ranking-Listen anführen, aber sich so gar nicht zum Träume verwirklichen anbieten.
Alles zum Thema „Urban Imagineering“ in XING 31mit Beiträgen von Julya Rabinowich, Richard Senett, Neil Brenner, Chiara Lorenzo u.a.m. Hier XING 31 online oder Ausgabe per Email bestellen, oder ein XING 31 :: Info herunterladen. |
Die Schweiz ist „happiest coutry in the world“. Das ist Fakt, laut dritten UN „World Happiness Report“. Selbstverständlich ist das so, denn die Schweiz gehört zu den reichsten Ländern des Planeten, kann eine eindrucksvolle Landschaft vorweisen und gehört zu den friedlichsten Ländern der Welt. Österreich ist übrigens das dritt-friedlichste Land, noch vor der Schweiz, die laut Global Peace Index an siebenter Stelle liegt.
Aber trotzdem, auch Österreicher fühlen sich in der Schweiz von Frieden und Sicherheit umhüllt. Die Züge gehen pünktlich, die Straßen sind sauber, Luft und Wasser sind rein. Wer wollte da nicht lieber Schweizer sein? John Kay, kein Österreicher aber Kolumnist der Financial Times, Fellow der Britisch Academy und Wirtschaftsprofessor an der London School of Economics.
”Boring“!!! Das Fällt Mr. Kay dazu ein und über Wien schreibt er in einem Artikel (FT, 17. September 2015): „Vienna is a marvellous city, but a museum“. Städte und Destinationen, die zwar die Wohlfühl-Rankings anführen, zählen seiner Meinung nach nicht zu den vibrierenden Orten dieser Erde, wo neue Ideen und die Welt von morgen entstehen. Wer Schmelzöfen für Wissen und Kreativität sucht, wird nicht an Zürich oder Düsseldorf denken, sondern sich nach London, New York, oder Barcelona begeben.
Die meisten kennen das Mercer-Ranking der lebenswertesten Städte, die von Wien angeführt wird. In fünf der zehn best-gereihten wird Deutsch gesprochen. Düsseldorf etwa liegt auf Platz sechs. Was fällt Mr. Kay zu Düsseldorf ein? „There may be a surer way to end a relationship than to propose a romantic weekend in Düsseldorf, but it is hard to imagine one.“
So sieht die Liste von John Kays Lieblingsstädten aus: Edinburgh, London, Paris, New York, Berlin, Sydney, Hong Kong, Barcelona, Venedig. Viele – ja wir geben es zu, auch die XING-Redaktion kann sich hier nicht ausnehmen – geraten ins Schwärmen bei dieser Liste. Wem ginge es nicht so? Aber was haben diese Städte, was Düsseldorf, Zürich und andere „lebenswerte“ Städte nicht haben?
Mit Ausnahme von Berlin sind die Städte der Kay-Liste nicht nur die schönsten, sondern auch die teuersten, auch wahrscheinlich deshalb, weil viele Menschen dort leben möchten. Warum eigentlich? In Venedig etwa drängen sich Massen durch viel zu enge Gassen, viele davon völlig verwirrt, weil man sich in diesem Labyrinth kaum zurecht findet. Für die Stadtverwaltung gibt es laut vieler Venezianer nur eine passende Beschreibung: hoffnungslos. Für einen guten Mercer-Rank ist das eine denkbar schlechte Ausgangsposition.
Düsseldorf hingegen gehört zu den Top-10 und mag zwar eine sehr „lebenswerte“ Stadt sein, aber „magic“ oder „spirit“ assoziiert kaum jemand mit „Düsseldorf“. Bei „New York“, „London“, oder „Barcelona“ schlägt unser Puls schneller und kommt bei „Hildesheim“, „Linz“ oder „Bern“ fast zum Stillstand. Es ist halt so, und es ist fraglich, ob eine noch so ausgeklügelte Branding-Strategie das je ändern kann.
Aber woran liegt das? Offensichtlich gibt es gravierende Unterschiede zwischen einer lebenswerten Stadt und einer „great city“, wie sie John Kay vorschwebt. Er glaubt, dass ein wesentlicher Faktor dabei das stadtarchitektonische Paradigma ist, das Rationalisten wie Le Corbusier vielen Orten einprägten. Ihrem Streben eine ideale Stadt zu bauen, gefertigt nach dem idealen Plan, der objektiv, modern und logisch ist, wäre die Lebendigkeit der Orte zum Opfer gefallen.
Für Kay sind Städte wie Chandigarh oder Brasília Fehlschläge. Sie sind groß, antiseptisch und völlig fremdartige Gebilde in der sie umgebenden Landschaft und Kultur. Dass diese Plan-Städte gescheitert seien zeige sich etwa auch an Canberra, der einzigen Stadt Australiens, die es in kein einziges Ranking schafft.
Ein Umdenken setzte ein, als zum Beispiel Jane Jacobs 1961 „The Death and Life of Great American Cities“ publizierte und den Planstädten die pulsierende Lebendigkeit gewachsener städtischer Raumkultur am Beispiel von Greenwich Village (Lower Manhattan) gegenüberstellte. Damals, in der Hochphase städtebaulicher Großprojekte, die New York zur autogerechten Stadt umgestalten und die chaotischen und sanierungsbedürftigen alten Stadtteile modernisieren sollten, streifte Jacobs Blick durch die Straßen und Plätze dieses städtischen Alltags. Ein Perspektivenwechsel setzte ein, der auch langsam das Ende von Robert Moses stadtplanerischen Absolutismus in New York einläutete.
Während Le Corbusier oder Moses Städte aus der Vogelperspektive betrachteten, arbeiten sich Mercer und Economist Intelligence Unit Abordnungen mit Checklisten durch Zahlenmaterialkolonnen. Können sie uns erklären was London von Düsseldorf unterscheidet? Wie aus friedlichen Happy-Städten „knowledge engines“ (John Lehrer) werden?
Orte, die Happiness- und Wohlfühl-Rankings anführen, bieten Sicherheit, sorgen für Sauberkeit und gut funktionierende öffentliche Verkehrsmittel. John Kay meint sogar das Gesetz von Jante, aus Aksel Sandemoses Roman „Ein Flüchtling kreuzt seine Spur“, in den lebenswerten Orten entdecken zu können. Jantes Dekalog beginnt mit dem Gebot, Du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist, und endet mit Du sollst nicht glauben, dass du uns etwas beibringen kannst. Sandemose expliziert hier Gesetze der kleinbürgerlichen Milieus, wo Bescheidenheit und Konformität die sozialen Spielregeln bestimmen. Soziale Homogenität, gemeinsame Werte, friedliches Zusammenleben und eine funktionierende Verwaltung verdichten sich zu einem zähen Anpassungsdruck, der alles nach vorne strebende lähmt, die Abweichung eindämmt, das Individuelle unterdrückt.
Viele Menschen hätten in Jante ihren Heimatort erkannt, so Sandemose im Vorwort einer überarbeiteten Ausgabe des Romans. Jante ist ein Gesetz, das man nicht zu kennen braucht, um es zu befolgen, es handelt sich vielmehr um eine Form der sozialen Unterdrückung, die sich die Menschen selber auferlegen.
Dass viele Menschen in einem solchen Umfeld zufrieden leben ist nachvollziehbar. Gemeinsame Werte, soziale Homogenität und ehrliche Beamte machen das Leben einfacher. Und ja, das geht ganz klar auf Kosten der individuellen Freiheit. Aber lebt es sich in unseren Lieblingsstädten, zum Beispiel Venedig, Barcelona oder Berlin, freier? Probieren Sie es aus und gehen Sie mit einem Lebensschutz-Plakat durch Berlin; oder flanieren Sie mit Ihrer Familie durch die Innenstadt von Barcelona, wenn vielleicht gerade gegen Touristen demonstriert wird und der Bürgermeister den Urlaubern „Go away!“ zuruft; und wenn Sie in Venedig mit einem Rollkoffer anmarschieren, haben Sie sich schon bei allen einheimischen Nachbarn unbeliebt gemacht. All das wird man Ihnen in Düsseldorf und Wien nachsehen. Vielleicht findet John Kay diese Städte deshalb langweilig?
Welche ungeschriebenen Gesetze durch soziale Kontrolle exekutiert werden und wie frei oder glücklich sich Menschen dabei fühlen ist vielleicht nicht der geeignete Gradmesser dafür, warum Barcelona cool und Düsseldorf als Stadt der Partykiller gilt. John Kay meint nun, dass ein Grund, warum so viele junge Menschen etwa von Melbourne oder Toronto nach London oder New York auswandern, der ist, dass sie Spannung und Kreativität suchen und eben nicht das langweilige lebenswerte Leben.
Glück hätte dann sehr viel mit dem Gefühl zu tun, einen „Flow“ zu erleben. „Flow“ wird als Zustand bezeichnet, den man zum Beispiel beim Computerspielen erlebt, wenn man das Spiel gut beherrscht und die Zeit wie im Fluge vergeht. Dabei sind die Anforderungen, die das Spiel an den Spieler stellt und das Können des Spielers in Balance: das Spielen ist nicht zu schwierig und nicht zu einfach. In diesem Zustand ist der Spieler ganz auf das Game konzentriert, wird nicht mehr abgelenkt, vergisst seine Umwelt, sogar Hunger oder Müdigkeit.
Die Chance das Leben in diesem Zustand zu erleben, dass Anforderungen und Erfolge als prickelnde Spannung, und nicht als grauer Alltag erlebt wird, ist das was „great cities“ von „boring cities“ unterschiedet. Für Mr. Kay ist es diese Aussicht, die auf ambitionierte Menschen magnetisch wirkt, die den Mehrwert erzeugen, den lebenswerte Städte nicht zu bieten vermögen. Für eine große Stadt, im qualitativen Sinn, braucht es diesen Mehrwert, der nicht mit sauberem Wasser, einer verlässlichen Müllabfuhr und größtenteils unbestechlichen Beamten herbeikonstruiert werden kann.
Wien zur Zeit von Harry Lime war genau so eine Stadt, als Orson Welles in Graham Greenes „Der dritte Mann“ durch die Kanalisation eilte. John Kay meint, dass Wien damals, in der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, zwar viel weniger lebenswert war, aber um vieles spannender. Kay endet seine Ausführungen mit einem Zitat von Lime, dem wir ebenfalls nichts hinzuzufügen haben: „In Italy for 30 years under the Borgias they had warfare, terror, murder and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland they had brotherly love, they had 500 years of democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock.“
Übrigens … John Kays neues Buch „Other People´s Money“ gibt es hier …



 argeMarie | Szenografie, Medien, Signaletik …
argeMarie | Szenografie, Medien, Signaletik … Cicero | Magazin für politische Kultur
Cicero | Magazin für politische Kultur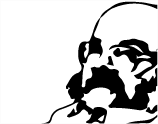 Michael Amon | undisziplinierbarer politischer Schriftsteller
Michael Amon | undisziplinierbarer politischer Schriftsteller Monocle | global affairs, business, culture, design
Monocle | global affairs, business, culture, design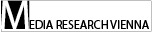 MRV | Media Research Vienna
MRV | Media Research Vienna Scenario Magazine
Scenario Magazine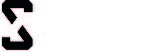 SOCIAL IMPACT Aktionsgemeinschaft
SOCIAL IMPACT Aktionsgemeinschaft Standpoint. Magazine
Standpoint. Magazine