Szenen aus der Provinz.
von Michael Amon.
Die Provinz hat einen unglückseligen Hang zur Urbanität. In gewisser Weise eine echte Mesalliance. Bevor wir uns aber diesem durchaus heiklen Thema weiter nähern, muss man wohl eine Begriffsdefinition vornehmen.
Alles zum Thema „Urban Imagineering“ in XING 31mit Beiträgen von Julya Rabinowich, Richard Senett, Neil Brenner, Chiara Lorenzo u.a.m. Hier XING 31 online oder Ausgabe per Email bestellen, oder ein XING 31 :: Info herunterladen. |
Provinz ist überall, so habe ich einmal ein Theaterstück untertitelt. Denn ganz einfach lässt „Provinz“ sich nicht verorten. Provinz ist kein rein geographischer Begriff. Provinz ist oft ein geistiger Zustand, denn Enge kann in den größten Städten sein (die Erfolge der FPÖ in Wien zeigen das), urbanes Denken ist auch jenseits der Städte möglich. Ein Problem entsteht dann, wenn mit provinziellen Mitteln Urbanität simuliert wird, wenn provinzieller Geist sich mit Gewalt als Urbanität inszeniert. Doch wie definiert man Provinzialität?
Marx und Engels schrieben im Manifest unverblümt: „Die Bourgeoisie hat … die Zahl der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem Grade vermehrt und so einen bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen.“ In der Zeit, als diese Zeilen geschrieben wurden, war die Sache klar: Land, also alles jenseits der Städte, ist provinziell und dem „Idiotismus“ verhaftet. Warum das so war, ist klar: ganze Talschaften waren, fern von den Zentren, hermetisch abgeschlossen, eigene Welten ohne wesentliche Außenkontakte für breite Schichten der dort lebenden Bevölkerung. Der Pfarrer und der Lehrer waren oft die einzigen Menschen, die mit der Welt „da draußen“ Kontakt gehabt haben. Nicht umsonst waren sie meist einflussreiche, angesehene Leute. Sie hatten die Welt gesehen, zumindest das, was damals in der Abgeschiedenheit der ländlichen Gegenden als Welt galt. In dieser Abgeschiedenheit entstanden örtliche Dialekte, von Tal zu Tal unterschiedlich und mit jeweils spezifischen Eigenschaften. Im Zillertal sprach man anders als im weiter westlich parallel verlaufenden Stubaital. Aber auch in einer Großstadt wie Wien gab es diese spezielle Form der Abgeschiedenheit: man konnte damals noch unterschiedliche Ausformungen des Wiener Dialekts je nach Bezirk unterscheiden (die Bezirke sind meist aus alten Vororten entstanden, als im Wien der Ringstraßenzeit die Stadtmauern gefallen waren und die Stadt sich rasant ausweitete). Ottakringer, Floridsdorfer oder Simmeringer konnte man anhand ihres Sub-Dialekts unterscheiden. Davon geblieben ist praktisch nichts außer dem Döblingerischen, das aber heute in ganz Wien existiert und eine soziale Distinktion ist.
Die modernen Verkehrs- und Kommunikationsmitteln haben im Laufe des 20. Jahrhunderts dazu geführt, dass diese einstige Abgeschiedenheit im Sinne einer Stadtferne (oder umgekehrt: einer Landesferne) zumindest im geographischen Sinne aufgehoben worden ist. Provinzialität manifestiert sich heute darin, dass die einstige Trennung der Welten aufgehoben ist: es dauert nicht mehr Wochen, bis bestimmte Nachrichten in ein fernes Dorf gelangen. Die nächste größere Stadt ist mit dem Auto oder anderen Verkehrsmitteln meist innerhalb weniger Fahrstunden erreichbar. Einst war der Besuch eines Vorortes von Wien inklusive Rückkehr eine Tagesreise. Heute sind dieselben Plätze teilweise innerhalb einer halben Stunde erreichbar. Geographisch ist die Welt zusammengerückt. Im Kopf aber nicht. Was also zeichnet heute jene Provinz aus, die vornehmlich eine Provinz des Denkens ist, aber eigentümlicherweise ihre krassesten Erscheinungsformen noch immer dort zeitigt, wo einst auch die geographische Provinz war? Es ist die Überschaubarkeit der Verhältnisse. Dazu kommt, dass die Provinz einst durch Abgeschiedenheit gekennzeichnet war, heute aber durch einen Mangel an Möglichkeiten definiert wird.
In kleinen Dörfern kennt jeder jeden. Das erzeugt Enge. Selbst in Kleinstädten kennt sich die „Oberschicht“ von Kindheit an, teilt ihre mitunter auch dunklen Geheimnisse. Man weiß um die Leichen im Keller des jeweils Anderen. Gleichzeitig herrscht Neid auf die wirklichen Städte. Man will ihnen nacheifern, um sich selbst zu „erhöhen“ und herauszukommen aus der selbst schmerzlich empfundenen Provinzialität. Gleichzeitig mangelt es aber sowohl an den finanziellen als oft auch an den intellektuellen Ressourcen. Die Budgets kleiner Orte sind beschränkt, die kleine Schicht der Entscheidungsträger köchelt im eigenen Saft auf kleinster Flamme vor sich hin. Querdenker werden scheel beäugt. Nicht, dass das in Großstädten immer anders ist. Aber die Konkurrenz im urbanen Raum ist größer, die Entscheidungsträger picken nicht jeden Tag in der Mittagspause beim örtlichen Stammtisch aufeinander, und vor allem müssen sie sich in der „echten“ Stadt intensiver mit wesentlich mehr Meinungen auseinandersetzen und stehen unter deutlich stärkerer „Kontrolle“ der Medien. Diese Kontrollaufgabe wird von den lokalen Medien, seien es Print oder TV, nicht wahrgenommen. Teils aus ganz persönlichen Gründen (man kennt sich von klein auf und sieht sich jeden Tag auf der Straße), teils aus politischen und finanziellen Gründen: die Eigentümer der lokalen Medien sind im vorwiegend konservativ geprägten ländlichen Raum eng mit der ÖVP und ihren Bürgermeistern verhandelt.
Dazu kommt der Mangel an Möglichkeiten. Das beginnt bei urbaner Infrastruktur: Theater, Museen, Kinos, Veranstaltungshallen, gut ausgebauter öffentlicher Verkehr, Kaffeehäuser, qualitätsvolle Gastronomie, all das gibt es nicht. Die Budgets von Dörfern und Kleinstädten sind beschränkt, gemessen an den Aufgaben. Die mühsam aufgebauten Strukturen erodieren unter dem Ansturm neoliberaler Privatisierungsideologie: Post und Bahn sollen gewinnbringend sein und vernichten Infrastruktur, Spitäler werden um ganze Abteilungen abgemagert. Durch die Flucht der Menschen in größere Städte sperren die Nahversorger zu, selbst der Kirchgang wird vielerorts zum Problem. Öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten und Volksschulen sind immer schwerer zu finanzieren. Das paart sich dann noch mit der Unfähigkeit der Funktionsträger, oft mehr eitle Gschaftlhuber als kompetente Verwalter von Gemeindebudgets.
Aus dieser Melange entsteht dann oft der Wunsch, es großen Städten gleichzumachen, ihnen wenigstens ansatzweise nachzueifern. Das führt oft zu grotesken Projekten, die durch wenig Kenntnis aber viel Größenwahn gekennzeichnet sind. Ich will das an einem Beispiel illustrieren.
Seit etwas mehr als zwei Jahrzehnten lebe ich abwechselnd in Wien und Gmunden. Letzteres ist eine Bezirkshauptstadt im Salzkammergut mit rund 13.000 Einwohnern und direkt am Traunsee gelegen, war einst Sitz der Verwaltung des Habsburgischen Salzmonopols und eine wohlhabende Kleinstadt. Die Habsburger gibt es seit Ende des Ersten Weltkrieges nicht mehr, der Wohlstand konnte aber über viele Jahrzehnte gewahrt werden. Teils durch die Beamten in Schule und Bezirksverwaltung, teils durch gut verdienende Handwerker, Kaufleute und Freiberufler. Dazu kam eine funktionierende Kleinindustrie bzw. die Ableger großer Konzerne. Durch falsche Raumplanung hat man zuerst die alte Struktur der Innenstadt zerstört. Dann kamen im Zuge der Globalisierung die Industriebetriebe unter die Räder, ebenso Niederlassungen internationaler Konzerne. Das Arbeitsplatzangebot wurde immer knapper, der Fremdenverkehr, ohnehin nie eine Stärke Gmundens, ging ebenfalls stark zurück. Man konnte sich nicht entscheiden, was man will: Fremdenverkehr, Industrie, Kurstadt, Keramikstadt etc. Im Endeffekt war man eines Tages nichts davon, erging sich aber in großmannssüchtigen Träumereien. Man wollte einen Tunnel unter dem See bauen, um die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten. Nach der extrem teuren Planungsphase war klar: viel zu teuer, das finanziert das Land OÖ nicht. Zehn Millionen öS hat man damals in den Sand gesetzt.
In den letzten zwanzig Jahren schlossen alle neu errichteten Hotels mangels Rentabilität und wurden zu Appartements (als Zweitwohnsitz für betuchte Nicht-Gmundner) umgewandelt. Dazu sperrten auch noch eine Reihe alter Hotels zu. Die Saison in Gmunden ist einfach zu kurz, die klassische Sommerfrische gibt es nicht mehr. Trotzdem setzte sich das Credo fest: Gmunden braucht ein Hotel. Weil eine Stadt ohne Hotel eben keine Stadt ist. Also schob man einem ÖVP-Gönner unter Mitwirkung aller Parteien (mit Ausnahme der Grünen) billig einen wertvollen Seegrund zu und hoffte, der würde ein Hotel bauen. Was nicht geschah – es fand sich kein Investor, da sich die Sache nie rechnen würde. Dafür ließ sich die Politik jahrelang mit Träumen versorgen: ein riesiger Hotelkobel direkt am See war geplant, mit Chalets inkl. einer neu zu errichtenden Bucht (Seevergrößerung) für reiche Bootsbesitzer. Eine Fata Morgana, von der sich die Stadtväter trotz vieler mahnender Stimmen nicht abbringen ließen. Eine Stadt ohne Hotel ist keine Stadt. Urbanität, wie man sie sich in der Provinz vorstellt. Das Hotel steht bis heute nicht.
Eine richtige Stadt braucht auch eine Universität. Also ging man daran, aus Gmunden eine Universitätsstadt zu machen. Hochfliegende Pläne, die man mit einer wegen Unterschlagung in einem öffentlichen Betrieb vorbestraften Betreiberin realisieren wollte. Alle Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Auch der Hinweis auf die mangelnde Qualifizierung und auf die früheren Malversationen der guten Dame wurden ignoriert. Versprach die Frau doch innerhalb von fünf oder sechs Jahren 800 Studenten vor Ort zu haben. Die Stadtpolitik träumte bereits von einer neuen Nutzung der brachliegenden Innenstadt: die würde zum Uni-Campus umgewandelt, Gmunden wäre Universitätsstadt und würde einen neuen Boom erleben. Dass das 1.000-seitige Konzept der Dame bereits einmal vom Uni-Beirat wegen wissenschaftlicher Mängel, irrealer Studentenzahlen und mangelnder Qualifikation der Betreiber abgelehnt worden ist, scherte die Gemeindepolitik nicht: man übernahm die Haftung für zwei Millionen. Was aus denen geworden ist, weiß man bis heute nicht. Sie verschwanden in einem vorgelagerten Verein. Ebenso wie die sinnlos ausgegebenen zigtausend Euro für weitere Studien zur Universitätsstadt. Alles Makulatur. Es gibt bis heute keine Uni in Gmunden. Von den hochfliegenden Plänen ist das als Verein geführte OÖ-Laserzentrum mit sechs Mitarbeitern geblieben: zwei Leiter, eine Sekretariatsmitarbeiterin, ein (!) wissenschaftlicher Mitarbeiter, und zwei Personen fürs Labor. Das wurde der Bevölkerung dann als Einstieg in die Universitätsstadt verkauft. Inzwischen ist es um die Uni-Pläne still geworden, über das verplemperte Geld spricht man nicht, und die Innenstadt stirbt weiter vor sich hin. Von Urbanität keine Spur.
Der optimistische Provinzpolitiker jedoch gibt seine hochfahrenden Pläne nicht so schnell auf. Um zu zeigen, dass man eine richtige Stadt ist, muss eine „Straßenbahn“ her, die eigentlich eine Eisenbahn ist (die Vorchdorfer-Bahn, die ab dem Klosterplatz auf einmal zur Tram mutiert). Die hat man auf Biegen und Brechen und ohne die Bevölkerung zu befragen durchgesetzt. Eine 32-Tonnen-Niederflurgarnitur soll jetzt zweigleisig durch die enge Durchfahrt der Altstadt fahren. Die lachhaften Kosten für 700 Meter neuer Geleise (mitsamt diversen Nebengeräuschen wie dadurch nötigen Brückenneubau und Anschaffung der Garnituren, neuer Haltestellen etc.) betragen mit der Finanzierung rund 60 Millionen Euro. Für eine Straßenbahn, die 170 Personen befördern kann, aber nach eigener Schätzung und Prognose der Betreiber pro Fahrt im Durchschnitt nur ca. 15 Fahrgäste aufweisen wird. Die erste errichtete Station ist ein Musterbeispiel schlechter Architektur und darin kaum noch zu übertreffen. Den meisten Gmundner Politikern und Teilen der Bevölkerung gefällt es. Die Betreiber jubeln: endlich atmet Gmunden den Flair der Urbanität (wortwörtlich!). Wer dagegen schon einmal in den dunkleren Winkeln Ottakrings war, der weiß, dass der Platz und die Haltestelle namens „Klosterplatz“ (die war mit dem urbanen Flair gemeint) weder den Charme der grindigen Ottakringer Vorstadt noch den der trostlosen Simmeringer Hauptstraße zwischen Rennweg und Wiener Zentralfriedhof erreicht. Die Gmundner Politik aber schwafelt von Urbanität. Zuerst hatte man die „kleinste Straßenbahn der Welt“, die auch entsprechend touristisch und völlig erfolglos als solche beworben wurde. Nun hat man die dümmste Bim der Welt und ergeht sich in Großmannssucht. Ein Projekt, das dem privaten Betreiber ohne jedes eigene Unternehmerrisiko voll aus Budgetmitteln von Stadt und Land OÖ (also vom Steuerzahler) finanziert wird. Risikolose Gewinne auf Kosten der Steuerzahler. Auch so kann man die Idee des öffentlichen Verkehrs ad absurdum führen. Aber man spürt geradezu den Sturm der Urbanität, der jetzt durch die Stadt fegt.
Offenbar kommen die politisch Verantwortlichen der geistigen Provinz nicht mit den Widersprüchen des modernen Lebens zurecht. Denn es gibt eine merkwürdige Paradoxie: das „Land“ will urban sein, koste es was es wolle. Das großstädtische Bürgertum in Österreich jedoch will um jeden Preis rural auftreten, möglicherweise ein Überbleibsel des austrofaschistischen Systems, dass versucht hat, den „unverdorbenen“ Charakter des katholisch geprägten Landes gegen die Verderbtheit der sozialdemokratisch dominierten Städte auszuspielen, und sich zu diesem Zweck trachtig verkleidet hat. Bis hin zu Trachtenumzügen in Wien, um den „Sozis“ zu zeigen, wie der liebe Gott es auch in der Stadt gern hätte. Dabei wurde wohl auch auf die Tradition von Kaiser Franz Josef zurückgegriffen, dessen Lieblingsbekleidung noch vor der Uniform das Jagdgwandl mit Krachlederner, Goiserern, Gamsbart und Trachtenjanker war. Das österreichische Bürgertum ist damals dem Kaiser nicht nur ins (unbestritten wunderschöne) Salzkammergut gefolgt (die Villen stehen noch heute), sondern die Angehörigen des Bürgertums haben sich ebenfalls als Jäger und Bauern verkleidet. Eine merkwürdige Camouflage, die so nur in den deutschsprachigen Alpenländern zu finden ist. Leider hat diese Verkleidung auch auf die Gehirne übergegriffen. Insofern hat die jetzige Renaissance von Tracht und Dirndl mitsamt Herrn Gabalieres Erfolgen und dem Höhenflug der FPÖ etwas Beängstigendes. Wir finden hier jedenfalls weltweit das einzige Bürgertum, das sich über Lodenmantel und Walkjacken definiert.
Man kommt letztlich zu einer ernüchternden Diagnose. Schon im 19. Jahrhundert gefiel sich das aufkommende Bürgertum, vorwiegend Industrielle, darin, sich die Schinken der Biedermeier-Maler wie Gauermann oder Waldmüller in ihre Häuser und Palais zu hängen. Man frönte so dem Idyll der verlorenen Natur. Dabei beruhte der eigene Reichtum auf der industriellen Zerstörung dieser Natur. Man holte sich das Idyll zurück ins eigene Heim, und sei es nur an der Wand. Oder in der Sommerfrische am Semmering und im Salzkammergut. Man gab sich rural und hatte mit der echten Landschaft und dem „echten“ Landleben nichts am Jagdhut. Man paradierte vor der Kulisse. Das ist bis heute so geblieben. Allerdings hat auch der rurale Stadtbewohner, durchaus ein Provinzler im Geiste, das Bedürfnis, seine Urbanität zu beweisen. Darum wurden inzwischen die Gauermanns und Waldmüllers gegen Nitsch und Konsorten getauscht. Damit beweist man, in der Moderne angekommen zu sein. Von wegen!
Am „Land“ funktioniert es genau umgekehrt. Dort will man um jeden Preis Urbanität vortäuschen. Man macht also auf urban. Mit Projekten, die nur die Illusion des Urbanen nähren, da für all das, was wirklich urban ist, weder die finanziellen noch die ideellen Voraussetzungen gegeben sind. Je größenwahnsinniger ein Projekt, umso städtischer fühlt man sich. Ob damit der von Marx und Engels beschriebene „Idiotismus des Landlebens“ beseitigt wird, darf man bezweifeln. Er hat vielmehr auch die Herrschaft über Teile des städtischen Lebens ergriffen. Die Grünen mit ihrem Radfahrwahn, ihrem Bio-Vegetarier-Vegan-Lifestyle und der Idee der ländlichen Idylle in der Stadt (Begegnungszonen!) sind ein gutes Symbol für diesen Vorgang. Insofern wurde zumindest eine Forderung des Manifests umgesetzt: „Hinwirken auf die allmähliche Beseitigung des Unterschieds von Stadt und Land.“ Wahrscheinlich haben Marx und Engels da irgendetwas anderes im Sinne gehabt, denn wir erleben eine reale Provinzialisierung des Urbanen, und zwar sowohl am Land als auch in den Städten bei gleichzeitiger Pseudourbanisierung des Ruralen. Die Protagonisten kommen bloß aus zwei verschiedenen Richtungen. Aber wer kann diesen Unterschied noch erkennen, wenn alle im geistigen Trachtenjanker rural durch die Gegend laufen und sich dabei für unglaublich urban halten? Wir können die Provinz also leicht verorten: sie ist in den Köpfen.



 argeMarie | Szenografie, Medien, Signaletik …
argeMarie | Szenografie, Medien, Signaletik … Cicero | Magazin für politische Kultur
Cicero | Magazin für politische Kultur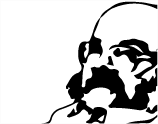 Michael Amon | undisziplinierbarer politischer Schriftsteller
Michael Amon | undisziplinierbarer politischer Schriftsteller Monocle | global affairs, business, culture, design
Monocle | global affairs, business, culture, design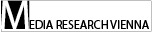 MRV | Media Research Vienna
MRV | Media Research Vienna Scenario Magazine
Scenario Magazine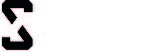 SOCIAL IMPACT Aktionsgemeinschaft
SOCIAL IMPACT Aktionsgemeinschaft Standpoint. Magazine
Standpoint. Magazine